Die «grüne» Wirtschaft und ihre Kosten
Durch das wachsende Bewusstsein für die voranschreitende Klimakrise und deren weltweiten Auswirkungen gibt es einen politischen und wirtschaftlichen Wandel weg von fossilen Energien hin zu sogenannten «grünen» Energien, auch bezeichnet als Energiewende. Die aktuellen technologischen Lösungen für die Energiewende erfordern besonders viele Mineralien und Metalle. Entsprechend entstehen neue Minenprojekte, um Mineralien wie Lithium, Kobalt, Kupfer und Aluminium abzubauen. Diese für die Energiewende notwendigen Mineralien werden Übergangs- oder Transitionsmineralien genannt. Lithium wird beispielsweise zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge benötigt: Im Jahr 2022 wurden 74 Prozent des weltweit verbrauchten Lithiums für Lithium-Ionen-Batterien verwendet.
Durch die Mineral-intensive Energiewende tritt der Rohstoffabbau in eine neue Phase und stellt durch vermehrte Minenprojekte Ansprüche auf Land. Dadurch bringt die Energiewende neue ökologische und soziale Risiken mit sich. Diese betreffen auch die Rechte Indigener Gemeinschaften: Eine Studie von 2022, welche weltweit 5’097 Minenprojekte für insgesamt 30 Übergangsmineralien untersuchte, hat ergeben, dass sich 54 Prozent dieser Projekte auf oder in der Nähe Indigener Territorien befinden. Die Planung und Durchführung der Minenprojekte setzen Indigenenrechte wie das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht auf Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC), das in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte Indigener Völker (UNDRIP) verbrieft ist, unter Druck.

Minen haben viele negative Auswirkungen auf die umliegende Natur und die in ihrer Nähe lebenden Gemeinschaften. Ein grosses Risiko besteht für die Wassersysteme: Minen haben einen hohen Wasserverbrauch und befinden sich gleichzeitig in Gebieten, die von hohen Wasserrisiken wie zum Beispiel akuter Wasserknappheit betroffen sind. 65 Prozent aller Lithium-Ressourcen beispielsweise kommen in Gebieten vor, wo bereits mittlere bis sehr hohe Wasserrisiken bestehen. Damit gefährden Minen sowohl den Trinkwasserbezug als auch den Wasserbedarf der Landwirtschaft Indigener Gemeinschaften noch zusätzlich, und sie verschmutzen oder vergiften das noch zur Verfügung stehende Wasser. Zudem werden weltweit über 220 Millionen Tonnen Minen-Abfall jährlich direkt in Seen, Flüsse und Ozeane ausgeschüttet und das Wasser somit nachhaltig verschmutzt. Die negativen Auswirkungen von Minen sind nicht immer schnell ersichtlich: Langfristige Umweltverschmutzungen und -zerstörungen sind oft schwieriger aufzuzeigen und stellen eine Form der «langsamen Gewalt» dar. Der Abbau von Mineralien führt ausserdem oft zur Umsiedlung von Gemeinschaften und zu grossen Infrastrukturbauten wie Strassen, Häfen oder Dämme, die weit über die Minen hinaus gehen. Dies gilt auch für weitere Projekte im Namen der Energiewende wie Wasser-, Wind- oder Photovoltaikbauten, welche auch ohne Abbau von Ressourcen Land einnehmen und somit Lebensräume stark einschränken.
Dass Indigenes Land ohne Zustimmung der vor Ort lebenden Gemeinschaften ausgebeutet wird, ist nicht neu. Dass dies nun unter dem Deckmantel «grüner» Lösungen fortgeführt werden soll, stellt eine Art «grünen Kolonialismus» dar, was Indigene Aktivist:innen immer wieder kritisieren. Der Begriff des «grünen Kolonialismus» bezeichnet die Fortführung kolonialer Besitzverhältnisse und Ausbeutung von Land unter dem Deckmantel der Ökologie. Die Ausbeutung von Mensch und Natur für Profit und Wirtschaftswachstum wird nun im Namen der «grünen Wirtschaft» gerechtfertigt. So zeigt beispielsweise der Fall der Fosen Windfarm in Norwegen auf Indigenem Land eine Form von «Green Grabbing». Der Begriff beschreibt die (koloniale) Aneignung von Land und Ressourcen zu ökologischen Zwecken. Es ist absurd, solche Projekte als «grün» zu bezeichnen – denn sie verschärfen Praktiken der Enteignung und Ausbeutung und reproduzieren Ungerechtigkeiten. Deshalb vertritt die GfbV die Meinung, dass Lösungen aus der Klimakrise nicht auf der Verletzung von Indigenenrechten basieren dürfen.
Als Mitglied der Securing Indigenous Peoples‘ Rights in the Green Economy Koalition (SIRGE Koalition) fordert die GfbV die Respektierung Indigener Selbstbestimmung durch das Recht auf Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC) für sämtliche Projekte, die Indigene Gemeinschaften tangieren, und priorisiert somit Lösungsansätze, welche den Fokus auf Klimagerechtigkeit legen.
Die SIRGE Koalition
Securing Indigenous Peoples’ Rights in the Green Economy (SIRGE) ist eine internationale Koalition, deren Lenkungsgremium aus Indigenen Vertreter:innen der sieben Indigenen Weltregionen besteht. Die SIRGE Koalition hat zum Ziel, Indigenenrechte in der «grünen Wirtschaft» zu sichern und für diese einzustehen, mit besonderem Fokus auf der Forderung nach Freiwilliger, Frühzeitiger und Informierter Zustimmung (FPIC). Die SIRGE Koalition besteht aus den fünf Organisationen Cultural Survival, First Peoples Worldwide, Batani Foundation, Earthworks und der Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz.
Beispiele von Aktivitäten der SIRGE Koalition:
- Unterstützung von Indigenen Gemeinschaften in ihrem Widerstand gegen Rechtsverletzungen durch Rohstoffunternehmen, unter anderem durch die Vergabe von Fördermitteln, Recherchen, Vernetzung, Aktionen und Shareholder Advocacy
- Dialog mit Elektroauto- und Batterieherstellern und Minenunternehmen darüber, wie sie Indigenenrechte respektieren können und in ihren internen Richtlinien und Prozessen verankern sollen
- Lobbying-Aktivitäten in Brüssel und den USA, um Indigenenrechte in allen relevanten Gesetzen zu verankern, die mit der Energiewende zu tun haben
Das Recht auf Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung
Das Recht auf Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung – auf Englisch Free, Prior and Informed Consent (FPIC) – beschreibt das Recht Indigener Gemeinschaften, zu allen Aktivitäten, die sie oder ihren Lebensraum betreffen ihre Zustimmung zu geben, zu verweigern oder zurückzuziehen. Besonders wichtig ist dies bei Bergbau- und Infrastrukturprojekten. Das Recht beschreibt die operative Umsetzung der Selbstbestimmung Indigener Gemeinschaften in Bezug auf Land, Territorien und Ressourcen. Es stellt sicher, dass Indigene Gemeinschaften bestimmen können, ob oder wie Projekte auf ihrem Land stattfinden dürfen. Für die Respektierung dieses Rechtes setzen sich die SIRGE Koalition und die GfbV ein. Die Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC) ist in der UNO-Deklaration über die Rechte der Indigenen Völker (UNDRIP) formuliert.
Definition der Freiwilligen, Frühzeitigen und Informierten Zustimmung
Freiwillig
Die Zustimmung erfolgt freiwillig und ohne Nötigung, Einschüchterung oder Manipulation. Der Prozess wird von der Gemeinschaft, welche um Zustimmung gebeten wird, selbst gesteuert und soll unbelastet von fremd auferlegten Erwartungen und Zeitvorgaben sein.
Frühzeitig
Die Zustimmung wird frühzeitig vor der Genehmigung oder dem Beginn von Aktivitäten eingeholt
und erlaubt somit, dass die Indigenen Gemeinschaften die notwendige Zeit haben, um ihre eigenen
Entscheidungsprozesse durchzuführen.
Informiert
Die Zustimmung ist erst dann angemessen eingeholt, wenn die Indigenen Gemeinschaften objektive und korrekte Informationen über die vorgeschlagenen Aktivitäten in zugänglicher Weise und Form erhalten.
Zustimmung
Zustimmung bedeutet die kollektive Entscheidung der Indigenen Gemeinschaften, ihre Zustimmung zu geben oder zu verweigern. Diese Entscheidung wird durch eigene Entscheidungsprozesse erlangt. Die Zustimmung kann Bedingungen beinhalten, welche von den Indigenen Gemeinschaften gestellt werden, und die Zustimmung kann zu jedem Zeitpunkt des Projektverlaufs wieder zurückgezogen werden.
Konflikte wegen Übergangsmineralien auf Indigenem Land

Ungleiche Geographien: Die weltweite Verteilung der Minenprojekte von Übergangsmineralien
Indigene Gemeinschaften verwalten mehr als einen Viertel des Landes auf unserem Planeten, welches zugleich 80 Prozent der übriggebliebenen Biodiversität beherbergt. Sie verwalten fast einen Fünftel des gesamten von tropischen und subtropischen Wäldern gebundenen Kohlenstoffs (218 Gigatonnen), ausserdem sind 40 Prozent der weltweiten Schutzgebiete in Indigener Verwaltung. Die Gebiete Indigener Gemeinschaften überschneiden sich somit weltweit mit den am wenigsten intensiv genutzten Naturräumen. Trotz dieser Verantwortung, welche Indigene Gemeinschaften gegenüber der Umwelt übernehmen, sind sie überproportional von der Klimakrise betroffen (durch Anstieg des Meeresspiegels, extreme Wetterereignisse, Dürren, Waldbrände und Küstenerosion).

Zusätzlich sind Indigene Gemeinschaften von den propagierten Lösungsansätzen der Energiewende und ihren Konsequenzen, nämlich dem vermehrten Abbau von Übergangsmineralien auf ihren Territorien, besonders negativ betroffen. So hat eine Studie von 2022 5’097 Minenprojekte von insgesamt 30 Übergangsmineralien untersucht. Die Minen sind auf der Weltkarte (siehe oben) als Punkte eingezeichnet. Die Studie kommt zum Schluss, dass sich 54 Prozent der Projekte auf oder in der Nähe Indigener Territorien befinden. Dass nun Indigene Gebiete nicht nur von der Klimakrise, sondern auch den Lösungsansätzen überproportional betroffen sind, bedeutet auch eine koloniale Fortführung der Besitzverhältnisse und Ausbeutung. Die Enteignung Indigener Gebiete für den Abbau von Bodenschätzen und durch die industrielle Entwicklung führt zu Umweltkonflikten.
Geopolitischer Kontext
Durch die Energiewende ist die Nachfrage nach Übergangsmineralien rasch und massiv gestiegen. Übergangsmineralien werden je nach politischen Kontexten auch als «kritische Mineralien» beschrieben. Der Begriff umfasst eine Reihe von Mineralien wie Lithium, Kupfer, Kobalt, Nickel und Seltene Erden, welche für die Energiewende und die damit einhergehenden Technologien als unerlässlich angesehen werden, bei denen es zu Lieferunterbrüchen kommen könnte. Dies führt zu geopolitischen Spannungen: Regierungen weltweit versuchen sich den Zugang zu Rohstoffen über sogenannte «strategische» Minen und Partnerschaften zu sichern. Dies führt in vielen Fällen zu einer Beschleunigung von Bewilligungsprozessen wie zum Beispiel bei der Genehmigung neuer Minenprojekte. Diese Beschleunigung wird auch «fast-tracking» bzw. Schnellverfahren genannt. So wurde zum Beispiel die Lithium-Mine beim Thacker Pass (Peehee Mu’huh) von der US-Regierung als «strategisch» kategorisiert und dadurch im Schnellverfahren genehmigt. Dies hatte zur Folge, dass Indigene Gemeinschaften, welche Bezug zu Peehee Mu’huh haben, weder durch die US-Regierung noch dem Minenunternehmen angemessen konsultiert wurden.
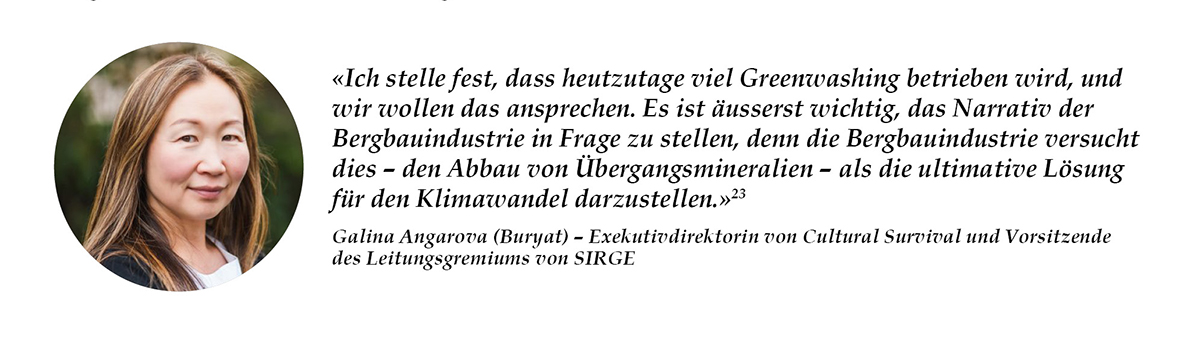
Beschleunigte Verfahren werden durch neue Regulierungen unterstützt. So wird in der EU beispielsweise derzeit der Critical Raw Materials Act (CRMA) ausgearbeitet. Das Gesetzespaket soll in Bezug auf «kritische» Rohstoffe die regionale Extraktion fördern sowie die Importe aus nicht-EU Ländern sichern und diversifizieren. Damit sollen die Lieferketten für die «grüne» und digitale Wende, aber auch für militärische Technologien, gesichert werden. Länder wie Australien, Brasilien, Peru und Südafrika haben ebenfalls die rechtlichen Grundlagen von Minenprojekten angepasst: Mit gelockerten Regulierungen sollen Anreize für vermehrte Investitionen in den Bergbau geschaffen werden.
Durch den wirtschaftlichen Wandel und die steigende Nachfrage nach Übergangsmineralien sind Investitionen in Projekte, welche aufgrund des Wandels boomen, auch für Schweizer Unternehmen und Banken interessanter geworden. Da solche Investitionen als dringlich gelten, werden nun Umweltschutzanliegen gegen Indigenenrechte ausgespielt und neue Konflikte geschaffen.
«Grüne» Projekte auf Indigenen Gebieten

Fallbeispiele zu Minen für Übergangsmineralien auf Indigenen Gebieten
Indigene Gemeinschaften sind überproportional von den negativen Auswirkungen des Bergbaus betroffen, wie der Global Atlas for Environmental Justice (EJAtlas) belegt. Dieser zeichnet weltweit Fälle von Umweltungerechtigkeiten auf und dokumentiert somit 1044 Konflikte, die 740 Indigene Gemeinschaften betreffen. Bergbau ist für fast einen Viertel der Umweltkonflikte verantwortlich und damit der grösste Verursacher aller Wirtschaftssektoren. Indigene Gemeinschaften auf der ganzen Welt protestieren zunehmend und unternehmen rechtliche Schritte, um die Wiederholung und Verschärfung kolonialer Ausbeutung und Gewalt beim Abbau von Übergangsmineralien zu stoppen.
USA: Lithium am Thacker Pass/Peehee Mu’huh
Im März 2023 hat das Unternehmen Lithium Americas mit dem Bau einer Lithiummine auf dem Berg Peehee Mu’huh begonnen. Peehee Mu’huh hat eine grosse historische, kulturelle und religiöse Bedeutung für die dort lebenden Indigenen Gemeinschaften. Diese geht auf das Massaker an den Indigenen Paiute durch die US-Kavallerie im Jahr 1865 zurück. Seither ist Peehee Mu’huh für die Paiute eine heilige Grabstätte. Der Bau der Mine auf Peehee Mu’huh stösst auf grossen Widerstand, da sich Indigene Aktivist:innen und Gruppen für den Schutz des Landes einsetzen. Denn sie rechnen damit, dass die Mine zusätzlich zur kulturellen Bedeutung des Ortes auch wichtigen Lebensraum für Wildtiere zerstört und das Grundwasser verschmutzt. Mit Slogans wie «Leben über Lithium» wehren sie sich gegen die Mine und machen deutlich, dass das Profitinteresse des Unternehmens Lithium Americas nicht über den Erhalt ihrer Lebenswelt gestellt werden darf.

Indigene Gemeinschaften sensibilisieren für die Folgen der geplanten Lithiummine in Peehee Mu‘huh für ihre heilige Grabstätte, Wasserressourcen und die Tierwelt. Foto: Chanda Callao/@Peopleofredmountain
Im Januar 2021 erteilte die US-Regierung die Lizenz für den Bau der Mine, welche zwei Milliarden Dollar wert ist. Die US-Regierung hat den rechtlichen Prozess zum Bau der Lithium Mine beschleunigt (sogenanntes fast-tracking), wodurch das Recht der Indigenen Gemeinschaften auf Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC) nicht beachtet wurde. Somit erhielt das Unternehmen Lithium Americas mit Sitz in Kanada die Baurechte. Laut der Lithium Nevada Corporation, Tochterunternehmen von Lithium Americas, soll die Mine am Thacker Pass die grösste Lithium-Quelle Nordamerikas werden.
Peehee Mu’huh ist beispielhaft für die Zunahme an Lithiumminen. In den USA befinden sich überproportional viele Minen von Übergangsmineralien innerhalb von 35 Meilen von Indigenen Territorien: 97 Prozent der Nickel-, 89 Prozent der Kupfer-, 79 Prozent der Lithium- und 68 Prozent der Kobalt-Minen. Die Indigene Gruppe «People of Red Mountain» wehrt sich für ihr Land und legte vor Gericht Berufung gegen den Bau der Mine auf Peehee Mu’huh ein. Der Rechtstreit ist noch nicht zu Ende. Gleichzeitig reichte das Tochterunternehmen Lithium Nevada Corporation eine Klage gegen das Camp Ox Sam der Aktivist:innen ein, mit dem diese den Bau der Mine stoppen wollten. Das Camp wurde am 8. Juni 2023 geräumt. Die SIRGE Koalition unterstützt die «People of Red Mountain» in ihrem Kampf um die Respektierung der Freiwilligen, Frühzeitigen und Informierten Zustimmung (FPIC).
Russland: Nickel- und Lithiummine von Nornickel
Der Rohstoffkonzern MMC Norilsk Nickel, genannt Nornickel, baut auf der russischen Taimyr-Insel Nickel ab. Nickel wird wie Lithium im Rahmen der Mobilitätswende unter anderem für die Batterien von Elektrofahrzeugen benötigt. Der Abbau bringt schwere Luftverschmutzung mit sich. Neben der Luftverschmutzung entsorgt das Unternehmen auch giftige Rückstände in der umliegenden Natur der Grossstadt Norilsk. Und es ist verantwortlich für eine der schwersten Umweltkatastrophen in der Arktis, das sich im Mai 2020 ereignete. Aufgrund nachlässiger Handhabung flossen in der sibirischen Stadt Norilsk 21’000 Tonnen Dieselöl in die umliegende Natur - ebenfalls Indigenes Land - und verschmutzten zwei Flüsse schwerwiegend. Für die betroffenen Indigenen Gemeinschaften waren die Auswirkungen der Katastrophe massiv: Die Rentiere haben das Gebiet wegen den Verschmutzungen verlassen, die Giftstoffe töteten die Fische, aber auch deren Nahrungsquelle, die Insekten. Dies führte zu einem Rückgang des Verkaufs von Fleisch und Fisch und entsprechend zu ausbleibenden Einkommen, wodurch die betroffenen Gemeinschaften auch weniger andere Nahrungsmittel einkaufen konnten.

Dieselöl im Fluss Piassino nach der Umweltkatastrophe in Norilsk. Foto: ZVG
Nornickel hat mit dem Unternehmen Metal Trade Overseas SA mit Sitz in Zug auch einen Ableger in der Schweiz. Die Firma vertreibt die in Russland und Finnland hergestellten Rohstoffe von der Schweiz aus in die ganze Welt. Das Unternehmen Nornickel geht nur oberflächlich auf die durch die Mine verursachten Probleme der Indigenen Gemeinschaften vor Ort ein – wie die Vergiftung des Lebensraums und der Bedrohung ihrer Lebensweise – und zeigt kein Interesse an Dialogen auf Augenhöhe mit Vertreter:innen der Gemeinschaften: Während das Unternehmen zwar Massnahmen getroffen hat, gab es jedoch keine Absprache über den Ablauf des Prozesses mit Indigenen Vertreter:innen, und die wenigen Entschädigungen, die erstattet wurden, gingen lediglich an die gegenüber dem Unternehmen unkritischen Stimmen. Die GfbV hat Indigene Partner:innen in ihren Forderungen gegenüber Nornickel zur Einhaltung des Rechts auf Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC) unterstützt.
Neu ist auf der Kola-Halbinsel in der Region von Murmansk ausserdem der Bau einer Lithiummine geplant, in dessen Rahmen Nornickel mit der staatlichen russischen Atomenergiegesellschaft Rosatom ein Kooperationsabkommen unterschrieb. Die Mine soll in Europas grösstem Wildnisgebiet, das bisher gänzlich frei von Infrastruktur wie Strassen ist, gebaut werden. Die Region des geplanten Bauorts steht unter der Verwaltung der Indigenen Samí, Nenzen und Komi. Diese befürchten eine starke Verschmutzung des Gebietes, einschneidende Konsequenzen für ihre Lebensweisen und sind gegenüber der von Nornickel angekündeten Konsultationsbereitschaft skeptisch. Während Nornickel und Rosatom hoffen, bereits bis Ende 2023 eine Fördererlaubnis zu erhalten, wurden laut Andrei Danilov, einem Partner der GfbV, nur ein kleiner Teil der betroffenen Gemeinschaften überhaupt kontaktiert, und dies erst in letzter Minute.
Norwegen: Kupfermine Repparfjord von Nussir ASA
Im Jahr 2014 plante die Bergwerkgesellschaft Nussir ASA eine Kupfermine auf Sámi-Land beim Repparfjord in Norwegen. Nussir ASA plante den Abbau von 50’000 Tonnen Kupfererz an den Orten Nussir und Ulveryggen (EJA). Der Kupfererzabbau und der Bau der dafür benötigten Infrastruktur sollte auf Sámi-Rentierzucht- land stattfinden und hätte die Rentierzucht stark eingeschränkt. Ausserdem war geplant, dass die Abfälle der Mine durch eine Unterwasser-Entsorgung direkt in den Fjord abgelassen werden. Die Schweizer Bank Credit Suisse (CS) war als Nominee Shareholder für damals unbekannte Kunden mit 20.6 Prozent Anteil der Aktien an Nussir ASA ebenfalls involviert. Die GfbV startete 2019 eine Kampagne zur Involvierung der CS mit dem Slogan «Stop banking against the Sámi!», um über die Öffentlichkeit Druck auf die Schweizer Bank und ihre Verantwortung in Bezug auf Indigenenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen.

In diesem Fjord, Repparfjord in Norwegen, plant Nussir ASA seit einigen Jahren eine Mine. Foto: Lea Ackermann / GfbV
Die Kupfermine hätte die Umwelt gefährdet und durch fehlende Konsultationsprozesse die Rechte der Sámi Gemeinschaften verletzt und ihren Lebensunterhalt beeinträchtigt. Im März 2019 reichten die Umweltorganisation Naturvernforbundet, das Sámi-Parlament und Rentierzüchter:innen Klage gegen die Erteilung der Betriebslizenz für Nussir ASA ein. Dies mit der Begründung, dass die Erteilung der Lizenz die nationalen sowie internationalen Rechte der Indigenen Sámi verletze. Im Dezember 2020 ging die CS auf die Forderungen der Sámi-Gemeinschaften und der GfbV ein: Die Bank gab die Aktienverwaltung der Anteile an Nussir ASA ab und schuf Transparenz über den zuvor vertraulich gehaltenen Eigentümer der Aktien, welcher sich nach den Gesprächen bei den Sámi meldete.
Der Planung der Kupfererzmine tat dies keinen Abbruch. Doch junge Aktivist:innen schlossen sich im Sommer 2021 am Ufer des Repparfjords lokalen Fischer:innen und Indigenen Sámi an, um den Bau der Mine durch Nussir zu blockieren. Ihre Anwesenheit erregte die Aufmerksamkeit der Aurubis AG, Europas größtem Kupferproduzenten, der bekannt gab, dass er seine Abnahmevereinbarung mit Nussir aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit kündigte. Momentan ist der Prozess des Minenbaus auch durch den Ausstieg verschiedener Investor:innen stagniert. Trotzdem ist die Mine weiterhin geplant und die Geschichte somit noch nicht abgeschlossen.
Norwegen: Windkraft-Anlage Fosen in Storheia
Auf der norwegischen Fosen-Halbinsel macht die Windkraftanlage des Unternehmens Fosen Wind DA grosse Teile der Winterweiden der Rentiere unnutzbar, wodurch Indigene Sámi-Rentierzüchter:innen ihre Lebensgrundlage grösstenteils verlieren. Mitinvestoren des Fosen Vind DA Konsortiums sind die beiden Schweizer Unternehmen Energy Infrastructure Partners (EIP) mit Sitz in Zürich, das von der Credit Suisse gegründet wurde, und die BKW Energie AG mit Sitz in Bern. 2013 reichten Rentierzüchter:innen beim norwegischen Ministerium für Erdöl und Energie Klage gegen die Windkraftanlage auf Indigenem Land ein. Das Ministerium lehnte die Klage ab und so wurde sie an den Obersten Gerichtshof von Norwegen weitergezogen. Dort wurde 2021 ein sensationelles Gerichtsurteil zugunsten der Sámi veröffentlicht. Darin erklärte das Gericht die insgesamt 151 Windturbinen in Storheia, die auf Indigenem Land stehen, für illegal. Gemeinsam mit Vertreter:innen der Süd-Sámi forderte die GfbV mit der Kampagne «Turbines Need Sami Consent» die Investoren Statkraft und Nordic Wind Power DA (wovon die Schweizer EIP und BKW Teil sind) auf, das Projekt zu stoppen, die Investitionen zurückzuziehen und das Recht auf Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC) für Indigene Gemeinschaften zu sichern.

Sami und Klimaativist:innen fordern im März 2023 die norwegische Regierung in Oslo auf, Indigenerechte durchzusetzen. Foto: Shutterstock
Obwohl das erwähnte Urteil des Obersten Gerichtshof den Sámi Recht gab, läuft die grösste Windfarm Europas weiter. 500 Tage nach dem Gerichtsurteil besetzten Sámi- und Klimaaktivist:innen den Platz vor dem Büro des norwegischen Premierministers Jonas Gahr Støre. Die Aktivist:innen – auch Greta Thunberg besuchte den Protest – betonten, dass die Wende zu «grüner» Energie nicht auf Kosten von Indigenenrechten umgesetzt werden dürfe. Einer der Slogans lautete: «Respect existence or expect resistance» (Respektiert Existenz oder erwartet Widerstand). Die norwegische Regierung hat sich seither entschuldigt und versprochen, die Suche nach Lösungen zur Umsetzung des Urteils zu beschleunigen, wobei die Rentierzüchter:in- nen aktiv an der Suche nach diesen Lösungen beteiligt werden sollen.
Klimagerechte Lösungen statt «Greenwashing»
Die oben beschriebenen Fälle sind beispielhaft: Durch den Bau neuer Minen und sogenannt «grüne» Projekte nehmen Umweltkonflikte zu, doch auch Indigener Widerstand wächst. Indigene Gemeinschaften setzten sich weltweit dafür ein, dass ihr Recht auf Selbstbestimmung und ihr Land nicht im Namen der momentanen Lösungen angesichts der Klimakrise geopfert werden. Mit dem Argument der Dringlichkeit darf die Energiewende nicht gegen selbstbestimmte Verwaltung von Land und Umwelt durch Indigene Gemeinschaften ausgespielt werden: Im Fall vom Thacker Pass gefährdet die Mine auch die Biodiversität oder im Fall vom Fosen Windpark die Indigene Rentierzucht. Regierungen und Unternehmen nehmen dies als notwendiges Übel hin.
Dies zeigen auch Entwürfe neuer Regelungen wie des oben erwähnten EU-Gesetzes zu «kritischen» Rohstoffen. Die mit dem Argument der Dringlichkeit gerechtfertigten beschleunigten Verfahren verhindern die Selbstbestimmung Indigener Gemeinschaften zusätzlich. Dies ermöglicht das sogenannte «Greenwashing», das beschreibt, wie Unternehmen und Regierungen profit-gesteuerte Projekte als ökologisch und klimaschützend vermarkten, um von den negativen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt abzulenken.

Damit kein neues Unrecht erzeugt wird und die Interessen und Rechte Indigener Gemeinschaften respektiert werden, sind klimagerechte Lösungen gefragt. Klimagerechtigkeit beschreibt ein umfassenderes Verständnis von Lösungsansätzen aus der Klimakrise und versteht soziale und ökologische Gerechtigkeit als nicht voneinander trennbar. Der Begriff kommt ursprünglich vom Englischen «environmental justice» (Umweltgerechtigkeit), den nicht-weisse und Schwarze Aktivist:innen in den USA im Kampf gegen die Entsorgung von giftigen Abfällen in nicht-weissen Gemeinschaften geprägt haben. Teil der Klimagerech- tigkeit ist die Forderung nach einer gerechten Transformation. Dazu gehört ebenfalls die Anerkennung der ungerechten Verteilung von Verursachung und Betroffenheit der Klimakrise, was in den Fällen um Indigene Selbstbestimmung über Land und Ressourcen besonders ersichtlich ist. Klimagerechtigkeit, die Energiewende und Indigenenrechte müssen vereinbar sein.
Dies erfordert ein umfassendes Umdenken bei der Energiewende, das die Vorteile für die von der Klimakrise am stärksten betroffenen Gemeinschaften und Ökosysteme in den Vordergrund stellt. Mögliche Lösungen für die Mobilität sind die Reduktion der privaten Autofahrten und die Maximierung der Kreislaufwirtschaft, sprich Batterie-Recycling, und die Verkleinerung von Elektroautobatterien. Die SIRGE-Koalition und somit auch die GfbV fordert, die Beteiligung Indigener Gemeinschaften dort zu garantieren, wo es Auswirkungen auf sie und ihr Land gibt oder geben könnte, und sich dabei an Indigenen Werten und Lösungen zu orientieren. Das Leitprinzip für den Abschluss von Geschäften und Partnerschaften ist es somit, Projekte von der Konzeption bis zur Fertigstellung durch die von Indigenen Gemeinschaften formulierten Protokolle des Rechts auf Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC) durchzuführen.
Forderungen der GfbV
Die Gesellschaft für bedrohte Völker engagiert sich für die Rechte Indigener Gemeinschaften im Zuge der Energiewende – insbesondere beim Abbau von Übergangsmineralien für die Elektromobilität. Sie steht dafür ein, dass vom Bergbau und Infrastrukturprojekten für die Herstellung erneuerbarer Energien (wie zum Beispiel Wind- oder Solaranlagen) betroffene Indigene Gemeinschaften vorgängig konsultiert werden und selbstbestimmt ihre Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC) geben oder verweigern können. Das Versäumnis eines Staates, internationale Standards in Bezug auf Indigenenrechte umzusetzen, mindert nicht die Erwartung, dass sich Unternehmen an diese Standards halten.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert von Regierungen:
- die in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der Indigenen Völker (UNDRIP) festgehaltenen Rechte, insbesondere deren Recht auf territoriale Selbstbestimmung, strikt einzuhalten und umzusetzen
- institutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Einhaltung der Indigenenrechte beim Rohstoffabbau zu garantieren
- für Bergbauprojekte, welche die Lebensweise und Territorien indigener Gemeinschaften betreffen, deren Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC) einzuholen. Indigene Gemeinschaften sollen in jede einzelne Phase eines Bergbauprojektes von der Exploration bis Abschluss und Renaturierung einbezogen werden. Dabei soll eine selbstbestimmte, von Indigenen Vertreter:innen geleitete Entscheidungsfindung garantiert werden
- das Übereinkommen über Indigene Völker (ILO Konvention 169) zu unterzeichnen und zu ratifizieren, wo dies noch nicht geschehen ist
Die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert die Schweizer Politik und Behörden auf:
- ein griffiges Konzernverantwortungsgesetz zu verabschieden, wie es die EU-Richtlinie über die unternehmerische Sorgfaltspflicht für nachhaltige Entwicklung (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD) Ausserdem sollte es eine unabhängige Aufsicht vorsehen, welche Beschwerden prüfen und Unternehmen sanktionieren kann. Diese sollte Unternehmen bei Verletzung der Sorgfaltspflicht haftbar machen
- die Offenlegung von Geschäftsbeziehungen zu gewährleisten
- in Handels- und Investionsschutzabkommen nebst Umweltstandards auch Mindeststandards zu Menschen- und Indigenenrechte zu verankern
- einen verantwortungsvollen Umgang mit Übergangsmineralien in der Strategie für Nachhaltige Entwicklung 2030 und im entsprechenden Aktionsplan sowie im Nationalen Aktionsplan “Wirtschaft und Menschenrechte” zu verankern
- den Rohstoffverbrauch zu reduzieren: Reduktionsziele in der Nachfrage (Produktion und Konsum) festzusetzen, die Kreislaufwirtschaft (bspw. Recycling von Batterien für Elektrofahrzeuge) zu fördern, Effizienzstandards festzulegen sowie Anreize für den Kauf kleiner Autos mit leichten Batterien zu schaffen
- das Übereinkommen über Indigene Völker (ILO Konvention 169) zu ratifizieren
- Greenwashing in der gesamten Wirtschaftskette und insbesondere im Finanzmarkt zu vermeiden, durch die Verankerung der menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung als Mindeststandard für als nachhaltig angebotene Finanzprodukte
Die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert Wirtschaft und Unternehmen auf:
Indigenenrechte und insbesondere das Recht Indigener Gemeinschaften auf Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC) zu respektieren, für die GfbV bedeutet das:
- Bei der Planung, Bau, Betrieb und Schliessung von Projekten:
- Indigenenrechte inklusive FPIC und UNDRIP in internen Richtlinien zu verankern und einen FPIC Prozess mit Indigenen Gemeinschaften zu garantieren
- Projekte von Initiativen mit strengen Menschenrechts- und Umweltstandards zertifizieren zu lassen, welche von unabhängigen Dritten überprüft und von der Zivilgesellschaft mitgesteuert werden (bspw. bei «Initiative For Responsible Mining Assurance» - IRMA)
- Bei Investition in und Finanzierung von Projekten sowie Bezug von Rohstoffen:
- Indigenenrechte inklusive FPIC und UNDRIP in internen Richtlinien, im Verhaltenskodex für Lieferanten und in Risikomanagementprozessen zu verankern und deren Umsetzung überprüfen
- Mitglied bei Initiativen mit strengen Menschenrechts- und Umweltstandards zu werden, welche von unabhängigen Dritten überprüft und von der Zivilgesellschaft mitgesteuert werden (bspw. Initiative for Responsible Mining Assurance - IRMA)
Wichtig: Unternehmen können die eigene menschenrechtliche Verantwortung nicht an solche freiwilligen Standards auslagern, sondern sollten diese als ein Instrument neben anderen nutzen
Die Gesellschaft für bedrohte Völker appelliert an die Öffentlichkeit:
- einen eigenen Beitrag zu leisten, vom Wegwerfkonsum und Individualverkehr wegzukommen und eine Kreislaufwirtschaft (Produkte recyclen, reparieren, wiederverwenden, umfunktionieren ) sowie öffentlichen Verkehr zu bevorzugen, um die problematische Gewinnung neuer Rohstoffe zu minimieren. Bei einem Autokauf kleine Autos mit kleinen Batterien zu priorisieren
- als Aktionäre nur in Firmen zu investieren, welche sich hohen Standards bezüglich Menschenrechte und Nachhaltigkeit verpflichtet haben
Die Gesellschaft für bedrohte Völker appelliert an alle Akteur:innen des Umwelt- und Klimaschutzes:
- klimagerechte Lösungen in der Energiewende zu fordern, welche die Indigenenrechte und die Interessen der vom Rohstoffabbau betroffenen Gemeinschaften als gleichwertig und untrennbar mit den Klimazielen verbunden sehen
- das Recht auf Selbstbestimmung Indigener Gemeinschaften und ihr Recht auf Freiwillige, Frühzeitige und Informierte Zustimmung (FPIC) in der Energiewende einzufordern
Die zum Klimaschutz dringend notwendige Energiewende darf nicht neue Menschenrechtsverletzungen auslösen. Es braucht klimagerechte Lösungen, welche Indigenen- und Menschenrechte respektieren.
Hier geht es zum Programm "Climate Justice! Respect Indigenous Consent":

Impressum
Herausgeberin: Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV)
Text: Nadira Soraya Haribe
Layout: Tania Brügger Márquez
Adresse: Birkenweg 61, CH-3013 Bern / Tel.: +41 (0) 31 939 00 00
Spendenkonto: Berner Kantonalbank BEKB: IBAN CH05 0079 0016 2531 7232 1
Ausgabe: September 2023

